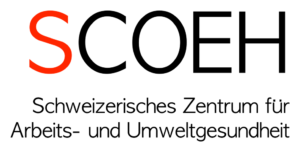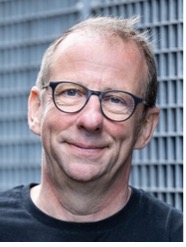Keimarme Luft dank
fernem UVC-Licht
Wissenschaftlich fundierte Eignungsprüfung und Risikobeurteilung für Betriebe
Was ist fernes UVC?
Fernes UVC ist eine neue Entkeimungstechnologie. Es bezeichnet typischerweise ultraviolettes Licht im Wellenlängenbereich um 200 bis 235 nm. Dieses ferne UVC-Licht reagiert stark mit organischen Stoffen und zerstört innert Sekunden luftgetragene Viren, Sporen und Bakterien. Bereits geringe Dosen erzeugen eine Reinigungsleistung, die einem mehrhundertfachen Luftwechsel mittels gängiger Systeme wie Belüftungsanlagen oder Luftreiniger entspricht. Gleichzeitig ist die Eindringtiefe in Festkörper für Wellenlängen zwischen 200 nm und 235 nm minimal, weshalb fernes UVC bei den verwendeten Dosen harmlos ist für Haut und Augen.
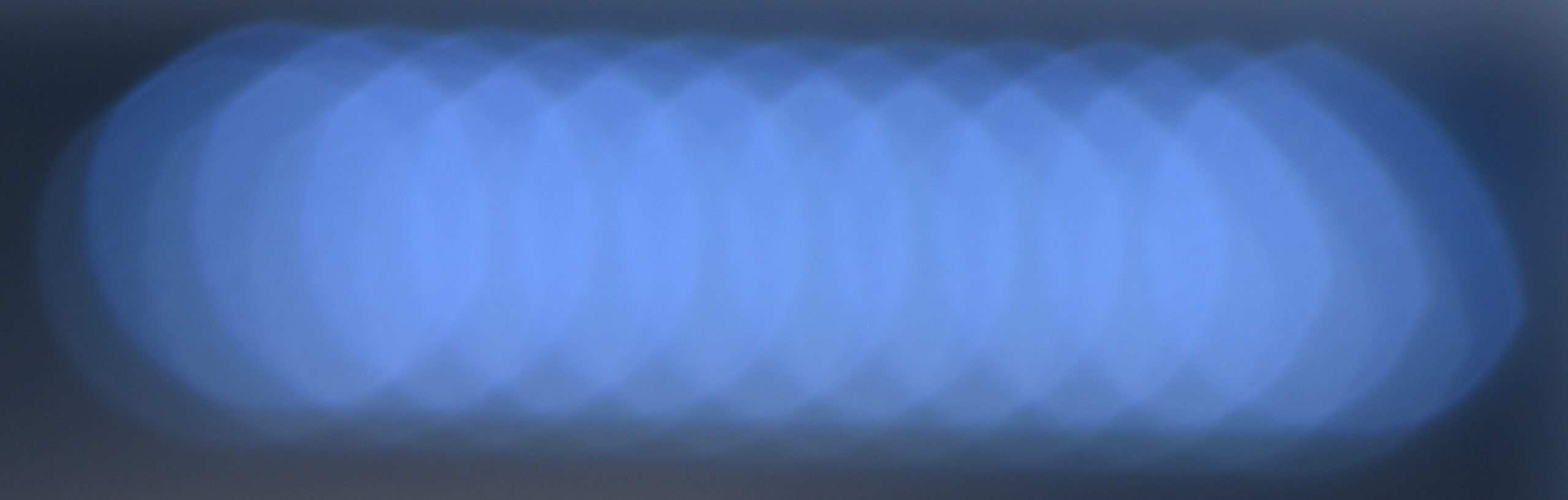
Wo wird fernes UVC eingesetzt?

Fernes UVC kann, anders als die traditionelle UV-Technik, direkt in Räumen bei Anwesenheit von Lebewesen verwendet werden. Es wird bereits in Spitälern, Kongresszentren und Gewächshäusern eingesetzt. Fernes UVC erleichtert die Versorgung mit keimarmer Luft erheblich: Es verbraucht im Vergleich zu traditionellen Methoden wie ultrareiner Lüftung deutlich weniger Strom und ermöglicht Keimentfernungsraten, welche diese gar nicht erreichen können.
Wichtig für den Einsatz von fernem UVC ist, dass die Lichtquelle wirklich nur fernes UVC-Licht im Wellenlängenbereich von 200 bis 235 nm freisetzt: „Traditionelles“ UV-Licht ist schädlich für Haut und Augen. Hände weg von ungetesteten Billiglampen!
Für welche Betriebe ist fernes UVC interessant?
Direkte Beleuchtung mit fernen UVC Lampen senkt das Ansteckungsrisiko in einem Raum enorm. Das prädestiniert fernes UVC für Spitäler und Pflegeheime, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Meetingzentren und alle Betriebe, welche auch während Krankheitswellen voll operationell sein müssen oder wollen.


Fernes UVC ist für Mensch und Tier unschädlich, tötet aber Viren sowie luftgetragene Pilzsporen und Bakterien sehr effizient ab. Daher ist der Einsatz von fernem UVC auch sehr interessant für Unternehmen, die sensible Produkte wie Lebensmittel, Kosmetika oder Medikamente in offenen Systemen produzieren, bearbeiten oder abpacken.
Was muss vor der Installation von fernem UVC abgeklärt werden?
Lampen, die fernes UVC freisetzen, können fast so einfach wie andere Lichtquellen installiert werden. An den für die Wirkung besonders wichtigen Punkten im Raum darf es keine Abschattungen geben. Ein Raum sollte aber nicht zu intensiv mit fernem UVC beleuchtet werden, denn dieses Licht kann in der Luft vorhandene Parfums, menschliche Ausdünstungen und Lösungsmittel in Schadstoffe umwandeln.
Vor dem Einsatz von fernem UVC muss daher sorgfältig abgeklärt werden, wo die Lichtquellen angebracht werden können, welche Intensität benötigt wird und wie stark sich das Licht auf die Luftqualität auswirkt. Dabei müssen minimal vier Kriterien geprüft werden:
- Spektralprüfung der Lampen: Bei jeder Lichtquelle von fernem UVC muss man sicherstellen, dass während der gesamten Lebensdauer wirklich nur die für Menschen ungefährlichen Wellenlängen freigesetzt werden.
- Intensitätsverteilung: Die Intensität des Lichts nimmt auf dem Weg von der Lichtquelle zum Wirkungsort ab. Dies hängt von der Anordnung der Lichtquellen und von in der Luft vorhandenen Gasen und Aerosolen ab. Die Messung der räumlichen Intensitätsverteilung des fernen UVC erlaubt Aussagen zur erwarteten Abtötungseffizienz [1].
- Schadstoffproduktion: Als Folge der Reaktionen von Molekülen in der Luft mit fernem UVC können Schadstoffe wie Ozon und Feinstaub entstehen. Zu viel von diesen Schadstoffen ist ungesund. Zudem können sie die Wirkung von fernem UVC im Raum behindern.
- Lüftung: Wie viele Schadstoffe sich im Raum ansammeln und wohin sich Krankheitskeime bewegen, hängt stark von der Lüftung ab. Daher müssen die erforderliche Luftwechselrate bestimmt und das Strömungsmuster dokumentiert werden.
Diese Abklärungen sind die Basis für einen Eignungstest und zugleich eine arbeitshygienische Risikobeurteilung. Sie beschreiben die vorhandenen Gefährdungen und helfen bei der Empfehlung von Massnahmen für den sicheren und erfolgreichen Einsatz von fernem UVC. Beispiele dafür sind Anpassungen der Lüftung, Verzicht auf bestimmte Putzmittel, welche die Schadstoffbildung fördern, oder optimierte Platzierung der fernen UVC-Quellen.
[1] In Laboren und Anlagen mit erhöhter biologischer Sicherheitsstufe, z.B. wenn mit pathogenen Organismen umgegangen wird, muss die Abtötungseffizienz der fertigen Installation vor Inbetriebnahme und nach jeder Wartung zusätzlich mit biologischen Indikatoren verifiziert werden.
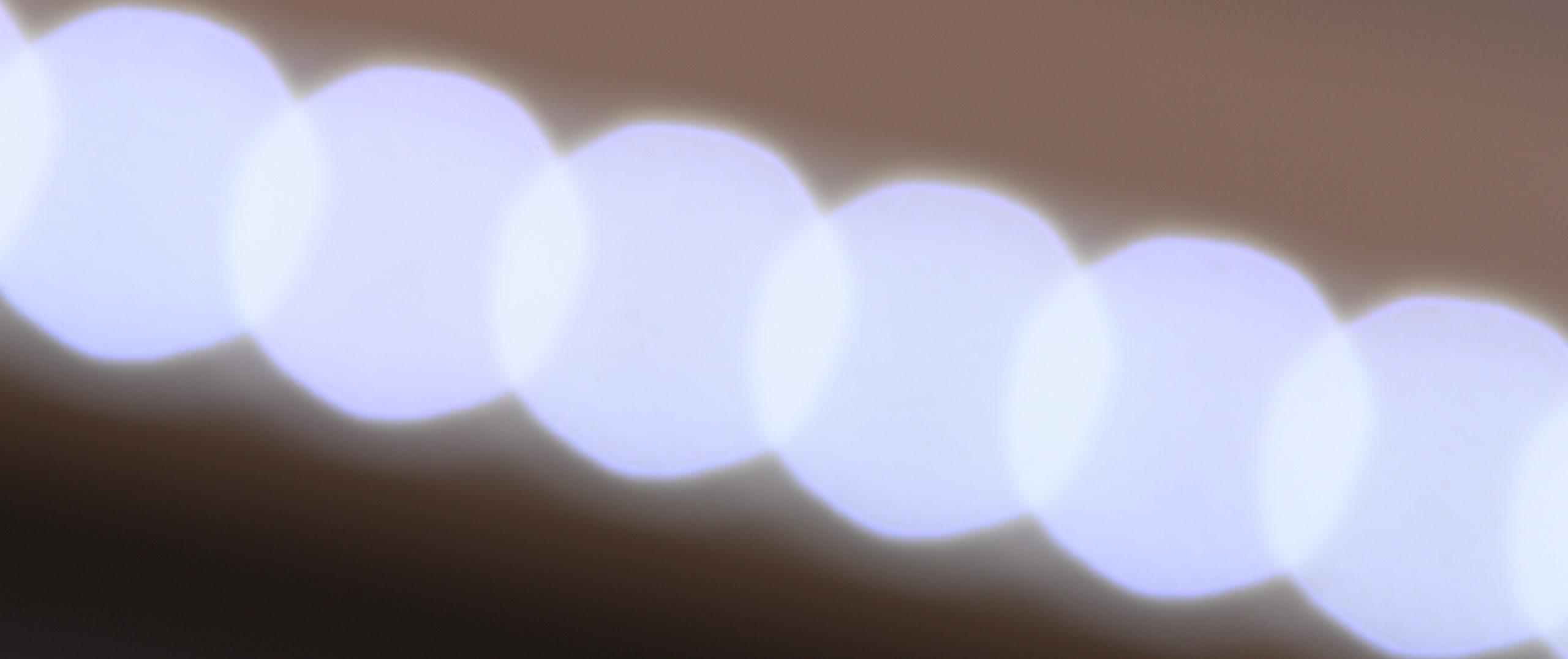
Wer wir sind und weshalb wir diesen Eignungstest kompetent durchführen können
Wir sind ein Team von Forschern mit sich ergänzender Expertise, die unabhängig von Herstellern die Chancen und Risiken von fernem UVC untersuchen. Mit diesem Eignungstest helfen wir Unternehmen, ihre Verantwortung für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden bei der Einführung dieser neuen Technologie wahrzunehmen. Dies führt zu einem besseren Wohlbefinden und zu einer Effizienzsteigerung durch weniger krankheitsbedingte Arbeitsausfälle. Wir bieten diese Dienstleistung zu einem nicht gewinnorientierten Tarif an. Im Gegenzug erhalten wir die Erlaubnis, die gewonnenen Daten in anonymisierter Form für unsere Forschung zu verwenden. So gewinnen wir wertvolle Informationen zu dieser neuartigen Technologie, zur Photochemie in Innenräumen und die damit zusammenhängenden Risiken und Chancen.
Das Team und seine Kompetenzen
Kontakt
Team Fernes UVC
c/o Schweizerisches Zentrum für Arbeits- und Umweltgesundheit
Binzhofstrasse 87
8404 Winterthur
Tel. +41 77 431 08 58
Email: „info scoeh ch“ mit @ und Punkt dazwischen.
Referenzen
Dies ist nur eine kleine Auswahl an wissenschaftlichen Publikationen, in denen Sie mehr zu den wissenschaftlichen Hintergründen erfahren können:
BAG (2022). Positionspapier des Bundesamtes für Gesundheit zur «Lüftung von Gebäuden in Pandemiesituationen». https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/wohngifte/gesundes-bauen/lueftung-von-gebaeuden-in-pandemiesituationen.html
SciAP (2023). Recommendation of the “Scientific Advisory Panel COVID-19” of the ETH Board on “Clean air in the context of pathogen circulation”. https://science-panel-covid19.ch/wp-content/uploads/230526_ReportWiBeG_EN_final-1.pdf
Buonanno, M., Welch, D., Shuryak, I., Brenner, D.J. (2020). Far-UVC light (222 nm) efficiently and safely inactivates airborne human coronaviruses. Sci. Rep., 10, Article 10285, https://doi.org/10.1038/s41598-020-67211-2
Brenner, D.J. (2023). Far‐UVC Light at 222 nm is Showing Significant Potential to Safely and Efficiently Inactivate Airborne Pathogens in Occupied Indoor Locations. Photochem & Photobiology 99, 1047–1050. https://doi.org/10.1111/php.13739
Collins, D. B., and Farmer, D. K. (2021). Unintended Consequences of Air Cleaning Chemistry. Environmental Science and Technology. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c02582
Görlitz, M., Justen, L., Rochette, P. J., Buonanno, M., Welch, D., Kleiman, N. J., Eadie, E., Kaidzu, S., Bradshaw, W. J., Javorsky, E., Cridland, N., Galor, A., Guttmann, M., Meinke, M. C., Schleusener, J., Jensen, P., Söderberg, P., Yamano, N., Nishigori, C., … Esvelt, K. (2023). Assessing the safety of new germicidal far‐UVC technologies. Photochemistry and Photobiology, php.13866. https://doi.org/10.1111/php.13866
Graeffe, F., Luo, Y., Guo, Y., Ehn M. (2023). Unwanted Indoor Air Quality Effects from Using Ultraviolet C Lamps for Disinfection. Environ. Sci. Technol. Lett. 2023, 10, 172−178. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.2c00807
Hessling, M., Haag, R., Sieber, N., Vatter, P. (2021). The impact of far-UVC radiation (200–230 nm) on pathogens, cells, skin, and eyes – a collection and analysis of a hundred years of data. GMS Hygiene and Infection Control; 16:Doc07. https://doi.org/10.3205/DGKH000378
ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. (2004). Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm (incoherent optical radiation). Health Phys. 87(2):171-86. https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPUV2004.pdf